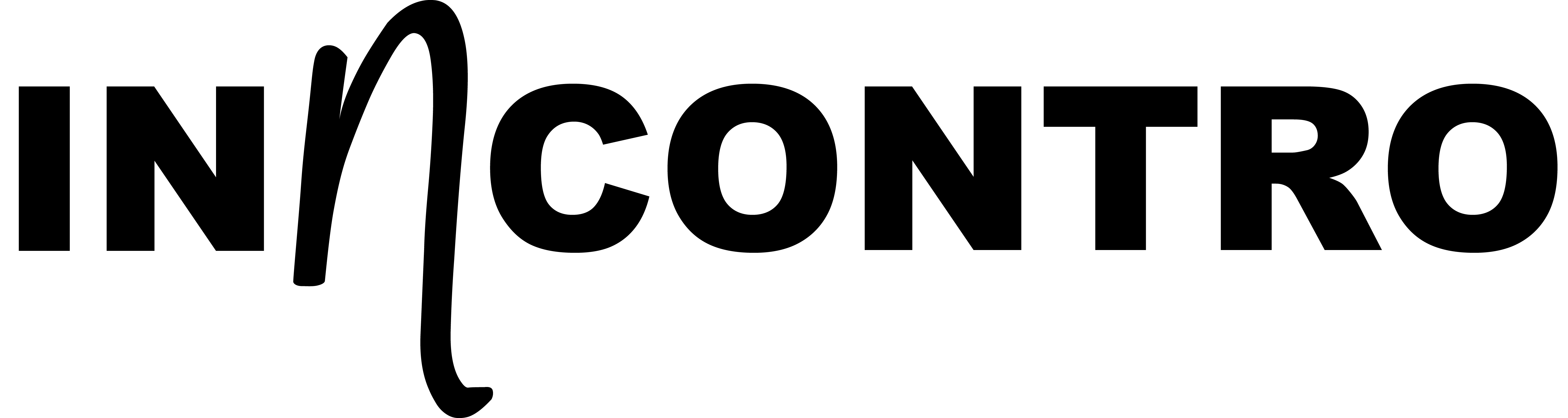Migration. Aktivismus. Widerstand.
Seit 2020 lädt das Inncontro Film Festival Journalist:innen oder Aktivist:innen ein, das Filmfestival zu begleiten und aus unabhängiger Perspektive ihre Kritikpunkte und Erfahrungen in einem Text festzuhalten. Heuer bedanken wir uns bei Cagla Bulut für die Teilnahme am Filmfestival sowie die Analysen und Gedanken zum Programm, die sie uns im folgenden Beitrag zur Verfügung gestellt hat.
Cagla Bulut ist freie Journalistin und fokussiert sich in ihrer Arbeit auf Menschenrechte, insbesondere Frauenrechte, Rassismus und Kultur. Aktuell produziert sie einen Dokumentarfilm, der sich der Identifikationsfrage postmigrantischer Frauen in Innsbruck widmet und ist dabei, die erste Folge ihres Podcasts „yallah, this way!“ herauszugeben – ein Projekt, das marginalisierten Gruppen eine Plattform bieten soll. Mehr Informationen: linktr.ee/cagla_bulut
Das diesjährige Inncontro Filmfestival war eine kritische Auseinandersetzung mit dem Dokumentarfilm als Medium, das gerade im Kontext von Migration oftmals der Gefahr aufsitzt, einen eurozentristischen Blick auf seine aufgezeichneten Sujets zu werfen aber gleichzeitig auch das Potenzial besitzt, minorisierte Realitäten sichtbar zu machen und Widerstände abzubilden. Der “weiße Blick” [1], das Hinterfragen des Rechts auf Mobilität reduziert auf bestimmte privilegierte Personengruppen sowie die migrantische Selbstermächtigung bildeten die Hauptthemen des Festivals und eröffneten neue Perspektiven.



Bild. Macht. Widerstand.
Ein Podiumsgespräch in der Kulturbackstube, die Bäckerei mit Beatrice Segolini (Editorin “The Valley”), Canan Turan (Creative Producer “From Here”), Gabriele Del Grande (Co-Regisseur “On the Bride’s Side) und Mala Reinhardt (Regisseurin “Der zweite Anschlag”), moderiert von Martine de Biasi (Regisseurin “Becoming Me”), eröffnete das Festival. Die Filmschaffenden wurden in diesem Gespräch unter anderem zu Grenzen und Ethik im Dokumentarfilm befragt: Inwiefern kann eine Montage von Bild- und Tonsegmenten die komplexe Realität aufzeigen? Wie gibt man als Künstler:in diese Grenzen im Film wieder? Wie stehts mit der Ethik im Film – wie tief dürfen die Einblicke sein, die man mit dem Publikum teilt? Wie weit dürfen Filmemacher:innen gehen, um die gewünschte Wirkung bei den Zuseher:innen zu erzielen und ab wann ist eine Entblößung der Charaktere moralisch nicht mehr vertretbar?
"On the Bride's Side" und "The Valley"
Diese Fragen wurden sowohl anhand der Filme, die im Rahmen des Festivals ausgestrahlt wurden, als auch allgemein beleuchtet. Problematisch in Hinblick auf die Ethik-Frage wirkten zu Beginn besonders die Filme “On the Bride’s Side” und “The Valley”.
“On the Bride’s Side” ist eine Aufzeichnung der Fortsetzung des Fluchtwegs von fünf Kriegsgeflüchteten aus Syrien und Palästina und wie sie versuchen, von Italien nach Schweden zu gelangen. Einige von ihnen glauben an eine bessere Zukunft dort, andere haben bereits Familie vor Ort. Ihren Fluchtweg sollen sie aber nicht allein meistern. Gabriele Del Grande, Co-Regisseur und wie er sich selbst nennt, enger Freund dieser Geflüchteten sowie ein Filmteam und weitere Freund:innen begleiten diese Menschen – ja, organisieren diese Reise sogar. Getarnt als Hochzeitspaar und Hochzeitsgäste reist die gesamte Truppe über den Landweg nach Schweden, um die Überquerung der Grenzen zu erleichtern und mögliche Polizeikontrollen zu vermeiden. Die Motivation hinter dem Plan laut Del Grande: “Wer würde schon ein zukünftiges Ehepaar und seine Gäste aufhalten?” – eine ziemlich gut ausgeklügelte und vor allem mutige Idee.
Die Problematik dieses Vorhabens ist allerdings die Tatsache, dass ein weißer [2] Journalist die verzweifelte Situation von diesen geflüchteten Menschen ausgenutzt haben könnte, um sein filmisches Projekt zu realisieren und sie somit in Gefahr gebracht haben könnte. Eine kritische Stimme kam von Canan Turan: “Ich glaub’s dir, dass ihr Freunde seid, aber was wäre passiert, wenn man euch aufgehalten hätte? Ihr würdet bestimmt unterschiedlich behandelt werden und würdet nicht die gleiche Verurteilung bekommen.”
Im Zuge der Filmpräsentation zwei Tage später erklärte Del Grande: “Wenn die Polizei uns auf so einer Reise aufhalten würde, hätten wir (italienische Staatsbürger:innen) ein Problem, nicht die geflüchteten Menschen. Sie würden lediglich zurück nach Italien gebracht werden, aber wir könnten mit einer Haftstrafe rechnen.” Del Grande betonte, dass die Geflüchteten in seinem Film nicht wie sonst üblich als Opfer dargestellt, sondern als Helden porträtiert wurden. Der Film sei überdies kein Film über Aktivismus, sondern eine Geschichte über die mediterrane Freundschaft.



Beatrice Segolini, Editorin des Filmes, brachte im Zuge der Diskussionsrunde selbst diesen kritischen Punkt an und wirkte sehr reflektiert über den Auswahlprozess, welche Szenen es letztlich ins finale Produkt schaffen und welche nicht. Sie scheint ein Bewusstsein für die eurozentristische Perspektive entwickelt zu haben und erklärte, dass sie besonderes Augenmerk auf die unschöne, doch realistische Darstellung gelegt hat. So hatte sie etwa einen weißen Aktivisten absichtlich nicht als Held porträtiert, sondern auch Szenen inkludiert, in denen man kolonialistische Denkweisen und Aussagen von ihm hört. Sie streut also keinen oder zumindest keinen erkennbaren Filter auf den Film und zeigt die Charaktere so gut es geht in ihrer ehrlichen, doch umstrittenen Ganzheit.
"Der zweite Anschlag"



Mala Reinhardt, Regisseurin von “Der zweite Anschlag”, hatte mit dem offensichtlich größten Konfliktpunkt des Dokumentarfilmfestivals im Kontext von Migrationsthemen, dem “weißen kolonialistischen Blick”, nicht zu kämpfen. Ganz im Gegenteil, als PoC-Künstlerin erklärte sie, dass ihre Migrationsbiografie bei der Filmarbeit eine große Hilfe war, um ein ehrliches Vertrauen zu den Protagonist:innen aufzubauen. Die Darsteller:innen im Film, alles Betroffene von rechtsextremer Gewalt – einer davon sogar Überlebender eines rassistisch motivierten Brandanschlags –, hatten bei vorigen Interviews mit weißen deutschen Journalist:innen und Medien negative Erfahrungen gemacht. Reinhardt erklärte, dass diese Journalist:innen bereits vor dem Gespräch mit den Betroffenen ihre eigene Geschichte im Kopf hatten und lediglich das passende Filmmaterial suchten, um ihre eigene Story auf die Leinwand zu bringen. Sie hätten kein ehrliches Interesse gegenüber dem, was wirklich geschehen ist, und kein offenes Ohr für die betroffenen Menschen gehabt.
Als Gastarbeiterkind, das selbst immer wieder rassistische Attacken (verbal als auch physisch) gegenüber meiner Person und meiner Familie erleben musste, berührte mich dieser Film besonders. Es gab einige Stellen im Film, an denen ich mir die Tränen nicht verkneifen konnte und den Saal verlassen musste, da die Erzählungen so ergreifend waren. Denn er ist ein Film, der den Narrativen der Hinterbliebenen von Opfern rassistischer Morde eine faire Plattform bietet. Und die Geschehnisse, Konsequenzen und das Versagen der deutschen Republik im Kontext der Erinnerungskultur pointiert artikuliert.
"From Here"



Auch “From here” bietet den Narrativen von Betroffenen von Rassismus eine Plattform. Der Dokumentarfilm begleitet seine Protagonist:innen über mehr als ein Jahrzehnt hinweg und wirft Fragen rund um Zugehörigkeit(en) und menschenfeindliche Migrationspolitik auf. Durch das jahrelange Dokumentieren der Leben dieser Menschen bekommt das Publikum das Gefühl, mit ihnen zu wachsen und baut dadurch ein großes Mitgefühl für sie und die ihnen auferlegten Schwierigkeiten auf. Stellenweise lässt sich der Film wie ein Stück Kunst betrachten und hört sich teilweise an wie Poesie. Besonders die Reflexionen über Zugehörigkeiten und das Zuhause des Künstlers und Aktivisten Akim Nguyen verleihen dem Film diese Note. Wenn er beispielsweise Dinge sagt wie: “This wanderlust is the negation of home.” (Dt.: Diese Wanderlust ist die Verneinung eines Zuhauses) und dass der Aktivismus ein existenzielles Bedürfnis für ihn ist.
Im Gegensatz zu “On the Bride’s Side”, der an einigen Stellen künstlich wirkende poetische Mittel einbringt, die trotzdem die Zuseher:innen nicht unberührt lassen, schafft es “From here” ungezwungen und natürlich eine kunstvolle Wirkung zu erzeugen.
Diskussion über die Erinnerungskultur und Archivpraxis


Warum beschäftigen sich all diese Menschen – und allgemein auch ganz viele Personen mit Migrationsbiografie – mit Aktivismus und investieren ihre Zeit und sicherlich auch ihre Nerven, damit Gewalttaten nicht in Vergessenheit geraten? Und ist es wirklich eine existentielle Notwendigkeit? Can Sungu, Forscher, Kurator und freier Künstler und Efsun Kizilay, Politologin und Kommunikationswissenschaftlerin, sagen im Rahmen der “Diese spontane Arbeitsniederlassung war nicht geplant”-Filmvorführung, dass Postmigrant:innen sich nicht damit auseinandersetzen müssten, wenn es die Mehrheitsgesellschaft getan hätte, und die Begründung leuchtet ein. Im Zuge ihres Gesprächs lenken sie auch die Aufmerksamkeit auf die Archivpraxis als politische Praxis: “Was wird archiviert? Was hat man gesehen? Was wird übersehen bzw. bewusst übersehen?”, stellt Erol Yildiz (Univ.-Prof. für Migration und Bildung), Moderator des Gesprächs, in den Raum.
Das bewusste Übersehen und Wegsehen seitens der Mehrheitsgesellschaft führte zu einer (post-)migrantischen Selbstorganisierung, in der die Menschen selbst ihre Rechte einforderten. Ein Beispiel dieses Einforderns im Kontext der Gastarbeiter-Migration ist der migrantische Arbeitskampf 1973 auf dem Ford-Werksgelände, der in “Diese spontane Arbeitsniederlassung war nicht geplant” dokumentiert wurde. Hier wurden die Appelle der Streikenden nicht nur bewusst übersehen und überhört, sondern mit Brutalität zurückgeschlagen.
"En Tierra Extraña"
Die Selbstorganisierung von Migrant:innen wird auch in “En Tierra Extraña” gezeigt. Der Film zeigt das Projekt „Ni perdidos ni callados“ (Dt.: „Weder verloren noch verstummt“) und thematisiert die Migration aus Spanien aufgrund der finanziellen Krise. Junge Spanier:innen mit Uni-Abschlüssen werden in Edinburgh, England gezeigt, wie sie Berufen in der Gastronomie und der Reinigung nachgehen und sichtlich frustriert über ihre Lage sind. Die meisten von ihnen beklagten die Sehnsucht nach Sonne, Familie und ihrem Zuhause, doch sehen offenbar keine Zukunft in ihrer Heimat. Es gäbe keine Jobs und wenn, dann seien sie schlechter bezahlt als ihre aktuellen Posten in England. Durch ihre Situation haben viele von ihnen mehr Empathie gegenüber Geflüchteten und deren Drangsal aufgebaut und hinterfragen das Konzept von Grenzen und Nationalismen nun immer mehr.
Ein Raum für Austausch und offene Gespräche
Das Infragestellen von Grenzen, Nationalismen sowie beschränkter Bewegungsfreiheit zog sich durch das gesamte Festival. Es wurde sowohl von der Perspektive der Betroffenen sowie der der Außenstehenden beleuchtet. Die ausgewählten Filme sowie das Festival boten Menschen mit Fluchterfahrung und Migrationsgeschichte eine Plattform – manchmal aus ihrer eigenen Sicht, manchmal aus der Sicht eines Freundes, einer aktivistischen Person oder eines Filmschaffenden. Damit verbunden wurden mögliche ethische Konfliktpunkte in Bezug auf den “weißen Blick” gemeinsam diskutiert und damit ein besseres Verständnis dafür entwickelt. Durch die offenen Gespräche seitens der Filmschaffenden konnte zudem ein stärkeres Bewusstsein für den Dokumentarfilm als begrenztes Medium, das immer einem Selektionsprozess unterliegt und kein ungetrübtes Fenster zur Realität ist, aufgebaut werden.
Alles in allem war es eine Festivalwoche, die den Themen Widerstand und Aktivismus ihre verdiente Aufmerksamkeit schenkte und damit verbunden Raum für Austausch für eine faire Zukunft des Dokumentarfilms bot.



[1] Der Begriff „Der weiße Blick“, abgeleitet aus dem Englischen „white gaze“, wurde von der afroamerikanischen Autorin Toni Morrison geprägt. Er weist auf den Missstand hin, dass Literatur, unabhängig davon, ob sie von weißen oder Schwarzen Autor:innen verfasst wurde, primär für eine weiße Leser:innenschaft und ihre Lebensrealität geschaffen wird. D.h., dass die weiße Perspektive die Norm bildet und nicht-weißen Perspektiven überlegen ist. Der Begriff macht heute weit über den Literatur-Bereich hinaus auf die Problematik des eurozentristischen/kolonialistischen Blicks aufmerksam.
[2] „Der Begriff weiß ist heute als soziale Kategorie der Privilegierung zu verstehen und nicht zwingend als Auskunft über den Hautton eines Menschen. Wenn jemand als weiß bezeichnet wird, dann bedeutet dies, dass diese Person durch Rassismus Vorteile genießt und Rassismus nur dann eine (spürbare) Rolle im Leben dieser Person spielt, wenn er oder sie sich bewusst für eine Auseinandersetzung mit Rassismus entscheidet.“ (Dina Yanni (2016): „Perspektiven auf Rassismus im Film. Grundlagen. Problemfelder. Fragen.“ Seite 14. Quelle: https://filminstitut.at/wp-content/uploads/2020/07/rassismusimfilm_dinayanni.pdf)